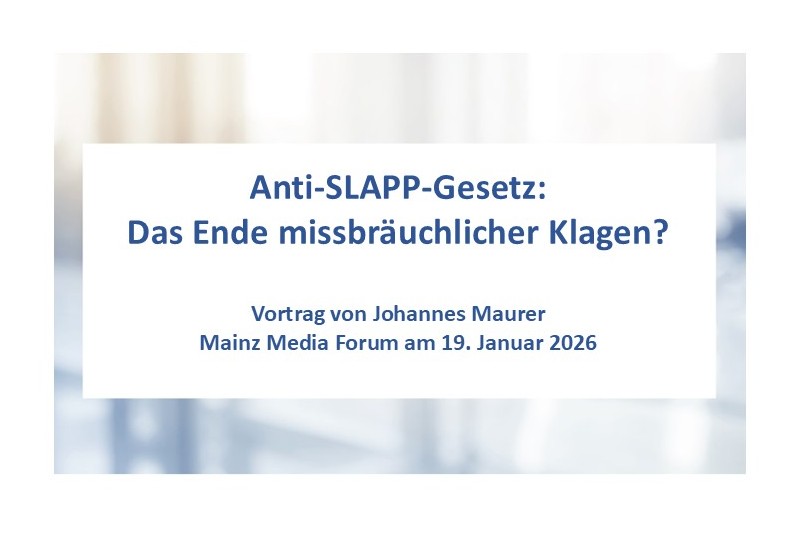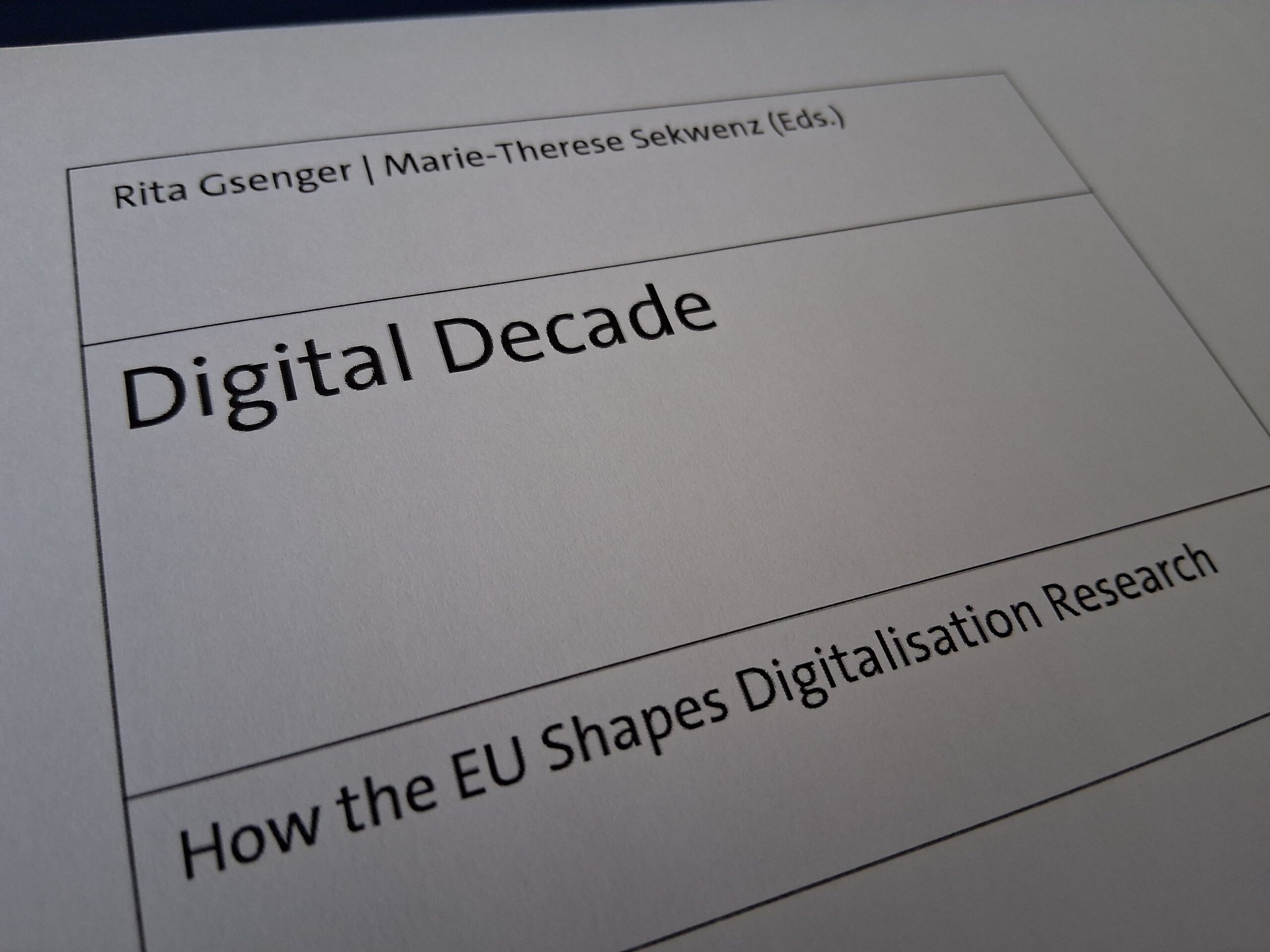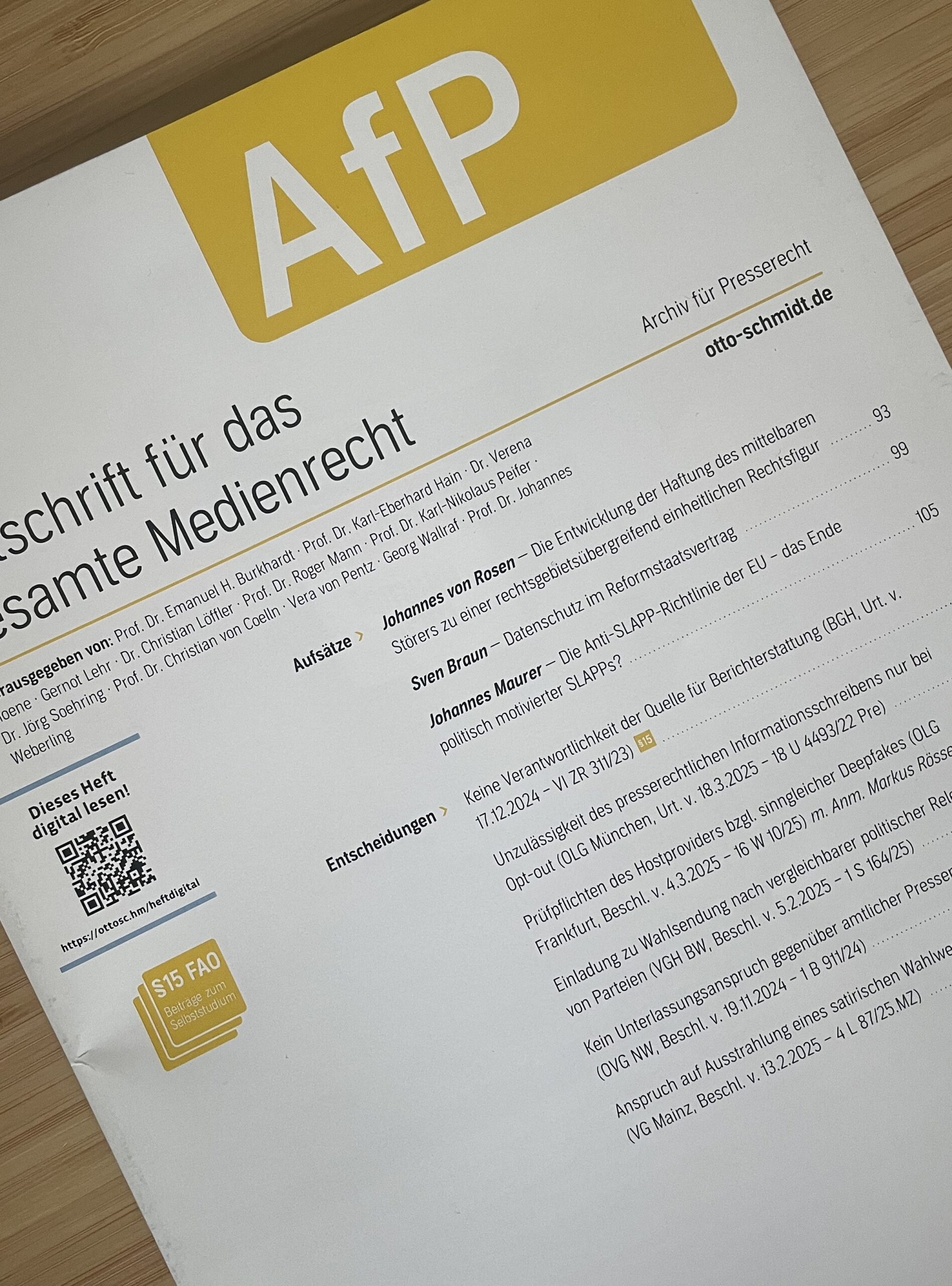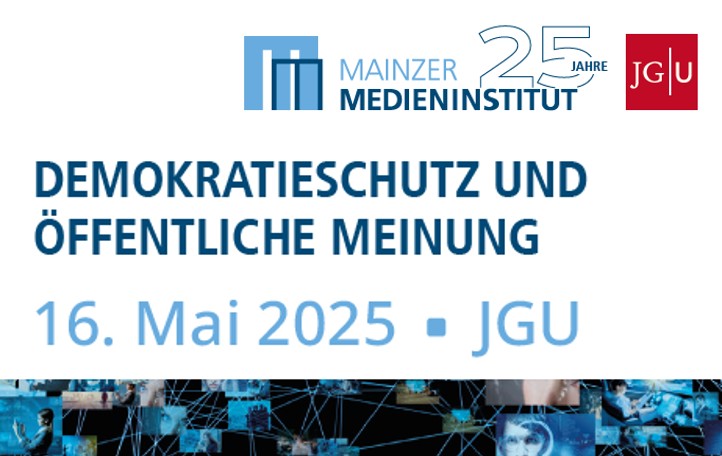Vortrag von Johannes Maurer
Im Frühjahr 2024 hat die Europäische Union eine Richtlinie erlassen, die sich erstmals legislativ mit sogenannten „SLAPP-Klagen“ auseinandersetzt. Damit hat der EU-Gesetzgeber einen Bereich betreten, der als Schwachstelle im hergebrachten Rechtsschutzsystem gilt: Wer ausreichend Ressourcen hat, kann Klagen gezielt einsetzen, um Gegner zu schikanieren – unabhängig davon, ob die Ansprüche, die Gegenstand des Verfahrens sind, Aussicht auf Erfolg haben oder nicht. Die Regelungen der Anti-SLAPP-Richtlinie sollen daher nun Klagen erschweren, die sich gegen die „öffentliche Beteiligung“ anderer Personen, also deren Teilhabe am demokratischen Diskurs, richten. Die Anti-SLAPP-Richtlinie bewegt sich somit an einer Schnittstelle zwischen Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrecht und prozessualen Grundrechten.
Bis Mai 2026 muss der nationale Gesetzgeber diese Richtlinie nun umsetzen. Ein im Sommer vorgelegter Referentenentwurf wurde durch den am 10. Dezember veröffentlichten Regierungsentwurf nochmals an entscheidenden Stellen überarbeitet.
Johannes Maurer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mainzer Medieninstitut, wird in seinem Vortrag dieses Umsetzungsgesetz vorstellen. Dabei wird er insbesondere auf die maßgebliche Umstellung des Regierungsentwurfs eingehen, die massive Auswirkungen auf den Anwendungsbereich der Anti-SLAPP-Regelungen haben.
Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit zu Fragen und Diskussion.
Termin:
Montag, 19. Januar 2026 um 17:00 Uhr
Die Veranstaltung wird als Online-Video-Konferenz durchgeführt.
Die Zugangsdaten erhalten Sie in einer separaten E-Mail
Wir bitten daher um Anmeldung bis zum 12.01.2026 an:
anmeldung@mainzer-medieninstitut.de
.
> Einladung